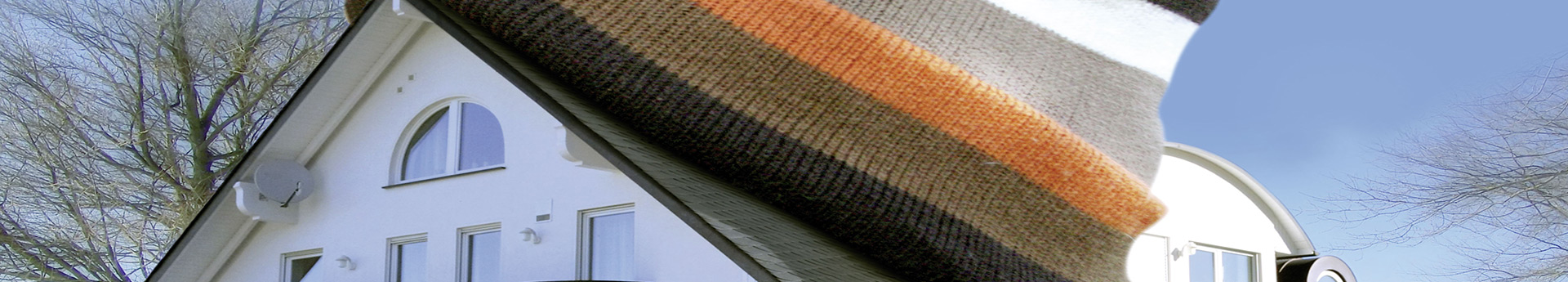
Wärmedämmung
„Die Leistung stimmt, wenn die Produkte darauf abgestimmt sind.
Deshalb beides von Getifix. Ganz bestimmt besser…“

Wärmedämmung mit Getifix
Für Energieeffizienz und Raumklima unersetzlich: die Wärmedämmung. Mit einem fachmännisch gedämmten Zuhause sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern sorgen mit wohltemperierten Räumen auch für angenehmen Wohnkomfort und ein gesundes Raumklima. Doch es neben verschiedene Möglichkeiten der Wärmedämmung, gibt es auch bei der Wahl der Dämmmaterialien einige Aspekte zu bedenken und einzukalkulieren.

Was ist Wärmedämmung?
Eine Wärmedämmung sorgt dafür, dass Ihr Haus so wenig Wärme wie möglich an die Umwelt abgibt, und sie vermeidet so Energieverluste in den eigenen vier Wänden. Neben angenehmen Temperaturen im Hausinneren, helfen gedämmte Wände und Decken die Heizkosten zu senken und den Wert Ihrer Immobilie zu steigern. Außerdem verhindert eine fachmännisch angebrachte Wärmedämmung, dass Bauteile wie Außenwände, Kellerdecken und Geschossdecken bei niedrigen Temperaturen auskühlen und sich Feuchtigkeit daran sammelt. Die Folgen eines solchen Wärmeverlustes sind schnell gravierend: Kondenswasserbildung, drohender Schimmelbefall und Schäden an der Bausubstanz.
Mit professionell gedämmten Bauteilen, lässt sich hier vorsorgen. Doch welche Möglichkeiten zur Dämmung gibt es? Grundsätzlich besteht die Möglichkeit ein Gebäude mittels Außendämmung, Kerndämmung oder Innendämmung vor vermeidbarem Wärmeverlust zu schützen. Während Erstgenannte häufig mit hohem Arbeitsaufwand verbunden sind oder nur in Einzelfällen nutzbar, eignen sich Innendämmungen für viele Anwendungsbereiche und stellen meist eine vollwertige Alternative dar.
Welche Möglichkeiten zur Dämmung gibt es?

Außendämmung – nicht immer realisierbar
Außendämmungen verhindern mit einem auf der Fassade befestigten Wärmedämmverbundsystem (WDVS) besonders effektiv Wärmebrücken und verringern dank der außen liegenden Fassadendämmung nicht die Wohnfläche. Doch für viele Eigenheime ist eine Fassadendämmung zum Beispiel aufgrund des benötigten Gerüstbaus sehr kostenintensiv oder schlicht nicht realisierbar. Das ist auch der Fall, wenn die Nähe zum Nachbargebäude die Befestigung des WDVS nicht zulässt, eine denkmalgeschützte Fassade nicht saniert werden darf oder eine einzelne Eigentumswohnung gedämmt werden soll. Auch die Dämmung einzelner Bauteile wie der Geschossdecken und Kellerdecken ist der Innendämmung vorbehalten.
Kerndämmung – Option für zweischaliges Mauerwerk
Kerndämmungen lassen sich auch nachträglich realisieren und eignen sich in einigen Fällen zur Wärmedämmung im Altbau. Damit eine Einblasdämmung vorgenommen werden kann, wird ein zweischaliges Mauerwerk benötigt, dessen Zwischenraum dann mit Schüttgütern, beispielsweise auf Perlitbasis, gedämmt werden kann. Dabei kann die Verteilung des Dämmmaterials allerdings in manchen Fällen erschwert werden, etwa wenn sich Bauschutt in den Hohlräumen befindet. Zudem bleiben Bauteile wie Ringbalken ungedämmt, wodurch Wärmeverluste drohen können.
Innendämmung – effektive Maßnahme mit Vorteilen
Ob eine Wärmedämmung im Altbau, im Arbeitszimmer oder für Kellerdecke ansteht: Eine Innendämmung sorgt für die gewünschte Energieeffizienz des Hauses und ein angenehmes Raumklima. Doch wie funktioniert Wärmedämmung von innen? Bei einer Innendämmung wird der Dämmstoff im Inneren des Hauses durch einen Fachbetrieb auf die Außenwände, Böden oder Decken gebracht. Für die Arbeiten wird in der Regel kein Gerüst benötigt und es kann jahreszeitunabhängig gearbeitet werden, was diese Form der Wärmedämmung sowohl zu einer zeitsparenden als auch kostengünstigen Maßnahme für Ihren Wohnkomfort macht. Während sich eine Fassadendämmung unter Umständen erst nach Jahrzehnten amortisiert, rentiert sich eine Innendämmung dank geringerer Kosten finanziell deutlich schneller.
Dämmung einzelner Bereiche
Mit einer Innendämmung lassen sich auch einzelne Bereiche des Hauses, wie Geschossdecken oder Kellerräume dämmen. Eine ideale Lösung, wenn Sie planen, den Dachboden oder den Keller auszubauen, um Ihre Wohnfläche zu vergrößern. Als Dämmstoff finden dabei häufig Klima- und Mineraldämmplatten Anwendung, die auf die Anforderungen des Raumes abgestimmt sind. Die fachmännische Verarbeitung gewährleistet, dass der Entstehung von Wärmebrücken sowie der Schimmelbildung bei der Dämmung effektiv vorgebeugt wird.
Wärmedurchgangskoeffizient – ein wichtiger Wert
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt Auskunft darüber, wie wärmedurchlässig ein Bauteil ist und beziffert in W/(m²*K), wie viel Wärmeleistung durch ein Bauteil pro Quadratmeter strömt. Doch welche Stoffe eignen sich als Dämmstoffe? Bei einer Wärmedämmung werden Materialien mit möglichst geringem Wärmedurchgangskoeffizient eingesetzt, wie gering diese bei Sanierungen und Neubauten ausfallen muss, ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgeschrieben, welches unter anderem die Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst hat. Verschärfungen haben sich durch die Überführung des EnEV nicht ergeben, die erforderlichen Wärmedurchgangskoeffizienten sind die gleichen geblieben.
| Bauteil | Alt (EnEV) | Neu (GEG) |
| Außenwände, Dachflächen, oberste Geschossdecke | max. 0,24 W/(m²k) | max. 0,24 W/(m²k) |
| Fenster (Standard) | max. 1,3 W/(m²k) | max. 1,3 W/(m²k) |
| Dachflächenfenster | max. 1,4 W/(m²k) | max. 1,4 W/(m²k) |
| Kellerwände | max. 0,3 W/(m²k) | max. 0,3 W/(m²k) |
(Quelle: https://www.energieheld.de/beratung/energetische-sanierung/geg ; EnEV 2014 Anlage 3 zu den §§ 8 und 9; GEG Anlage 7 zu § 48)
Wärmedämmung und Raumklima
Von zentraler Bedeutung ist bei der Innendämmung darüber hinaus die Verwendung diffusionsoffener und feuchteverträglicher Materialien, wie die der Getifix Klimaplatte oder der Mineraldämmplatte ambio. Die mineralischen Dämmplatten sorgen nicht nur für eine deutliche Reduzierung der Heizenergie, sondern auch für eine Verbesserung des Wohnklimas und beugen damit Kondensationsfeuchte und Schimmelpilzbildung vor. Das Calciumsilikat oder der Mineralschaum lassen Wasserdampf passieren und nehmen die Feuchtigkeit der Raumluft auf, bevor diese kondensiert. Die hohe Kapillarität sorgt dabei dafür, dass die Feuchtigkeit großflächig verteilt und gespeichert wird, wodurch der Dämmstoff als verlässlicher Kondensationspuffer dient.

Einsatzgebiete der Getifix Klimaplatte:
- Verhinderung von Schimmelpilzwachstum
- Verbesserung der Wärmedämmung
- Aufnahme der zu hoher Luftfeuchtigkeit
- Vermeidung von Kondenswasserbildung
- Erzeugung eines gesunden Raumklimas
Die Getifix Klimaplatte eignet sich mit ihren Materialeigenschaften ideal zur Dämmung warmer Innenbereiche. Mit ihrer hohen Kapillarität nimmt sie überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft auf und schafft so ein gesundes Raumklima.
Getifix ambio – die natürliche Mineraldämmplatte
Unter den modernen Dämmsystemen von Getifix finden Sie passgenaue Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen der Bauphysik eines Gebäudes. So erhalten Sie mit der Getifix ambio eine natürliche Mineralplatte, die speziell für die effiziente Innendämmung von Außenwänden und Deckenflächen entwickelt wurde. Die dampfdurchlässige Platte besteht aus vollkommen natürlichem Material, ist frei von Fasern sowie Kunststoffen und verfügt dabei über einen besonders geringen Wärmedurchgangskoeffizienten. Die leichtgewichtige Platte eignet sich ideal, um auch einzelne Räume oder Geschossdecken nachträglich zu dämmen.

Einsatzgebiete der ambio Mineraldämmplatte:
- Wärmedämmung von Außenwänden im Innenbereich
- Wärmedämmung von Deckenflächen im Innenbereich
Die ökologische Getifix ambio Mineralplatte dient der effektiven Wärmedämmung von Außenwänden sowie Deckenflächen im Innenbereich und wird wohnbiologisch empfohlen.
FAQ – Fragen und Antworten zur Wärmedämmung
Ich möchte die Fassade meines Hauses erhalten – gibt es eine Alternative zur Dämmung von außen?
Möchten Sie bei der Wärmedämmung die Fassade Ihres Hauses erhalten, oder lässt der Denkmalschutz eine Außendämmung nicht zu, können Sie mit einer Innendämmung ebenfalls hervorragende Resultate erzielen und Wärmeverluste verhindern. Eine professionell durchgeführte Innendämmung ist in vielen Fällen eine deutlich kostengünstigere Alternative zur Außendämmung und amortisiert sich somit deutlich schneller. Neben einer besseren Energieeffizienz Ihres Hauses sorgt eine Innendämmung zudem für ein verbessertes Raumklima, das Schimmel nachhaltig vorbeugt.
Was kostet eine Wärmedämmung?
Die Kosten der Wärmedämmung hängen sehr von der gewählten Dämmerart und der gedämmten Fläche ab. In vielen Fällen ist eine Innendämmung eine kostengünstige Wahl, da hier Gerüstkosten gespart oder einzelne Räume gedämmt werden können. Für die Durchführung und Planung von Dämmarbeiten sollten Sie jederzeit die Kompetenz eines Fachbetriebes in Anspruch nehmen. So ist nicht nur eine fachkundige Planung, sondern auch fehlerfreie und effektive Durchführung sichergestellt.
Welches Material für Wärmedämmung?
Bei der Wärmedämmung des Hauses gilt es, Materialen mit einem geringen Wärmedurchgangskoeffizient zu verwenden. Bei einer Wärmedämmung im Innenbereich ist zudem die Verwendung diffusionsoffener und feuchteverträglicher Materialien, die Kondensationsfeuchte sowie die Bildung von Schimmel verhindern. Mineralische Dämmplatten, wie die Getifix Klimaplatte und Getifix ambio, gewährleisten mit ihrer Kapillarität eine flächige Speicherung der Feuchtigkeit und dienen gleichermaßen der Energieeffizienz und Verbesserung des Raumklimas.
MEHR ZUM THEMA WÄRMEDÄMMUNG
Innendämmung mit mineralischen Klimaplatten
Eine Innendämmung ist ein Gewinn für Ihr Haus, wenn Bauteile Wärme verlieren und eine Außendämmung nicht infrage kommt. Erfahren Sie hier, welche Dämmstoffe es gibt und welche Vorteile eine Innendämmung der Außenwände mit sich bringt.
Raumklima – Ratgeber mit Wissenswertem & Tipps
Ein gutes Raumklima steigert die Wohnqualität. Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und weitere Faktoren beeinflussen das Raumklima. Wie Sie das Raumklima verbessern können, erfahren Sie in unseren Ratgebern!
Richtig heizen – Heizungsleitfaden und Tipps
Um Heizkosten zu senken und Energie zu sparen, sollten Räume richtig beheizt werden. Erfahren Sie hier, was Sie beim Heizen beachten müssen, welche die richtige Raumtemperatur ist und warum eine Nachtabsenkung sinnvoll ist.
Mineraldämmplatten – Definition und Vorteile
Um Wärme in den Wohnräumen zu halten, müssen diese fachgerecht gedämmt werden. Erfahren Sie, welche Vorteile Mineraldämmplatten mit sich bringen, wie sie funktionieren und hergestellt werden.





